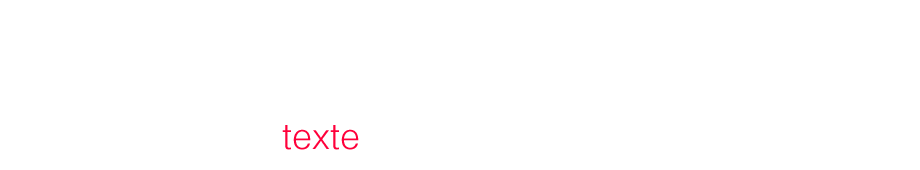
aktuell
termine
projekte
publikationen
presse
kontakt
newsletter
arbeiten
the virtual mae
local to local
transitorische räume
B1.21st
places to be
all is well and will be well
out of focus
faustrecht vs. freiheit
zimmer mit aussicht
countrylife
bruxelles encounter
der zwischenfall im ...
vita
kontakt
impressum
Countrylife
Autor: Markus Ambach, zur Arbeit von Sid Gastl
Katalog "Förderpreis der Stadt München", 2001
Seit die meisten von uns denken können, leben sie in Städten. Städte sind die selbstbestimmte Form unserer selbst, in der wir unser Umfeld organisieren, um wochenends in einer durch uns domestizierten Natur von uns selbst auszuspannen. Neben dieser streng organisierten Ländlichkeit gibt es dort nur einige verstreute Zeichen von Zivilisation: ein Zaun, eine Hochspannungsleitung, Strohballen, hier und da eine kleine Liegenschaft.
Alles in allem recht friedlich, würde man denken, nährte nicht etwas hartnäckig einen beunruhigenden Verdacht: Man weiß - die wühlen da in dunkler Erde, da wird umgegraben, verschüttet, verladen, viel Materie bewegt, hinter verschlossenen Türen produziert, was uns ernährt und immer wenn man sich nähert , ist gerade keiner da: die Wirtschafts-gebäude liegen ruhig und bewegungslos, die Scheunen gefüllt und veschlossen, kein Laut ist zu hören, das unter den Planen vermutete Etwas schon zu Ballen verschnürt und verpackt: weiße Rollen, grüne Container, graue Silos- alles fertig, alles sortiert, gefüllt und zum Abtransport bereit.
Warum und von wem diese Betriebsamkeit, um all das Zeug hierher- und wegzuschaffen, hierher in dieses Nichts, in diese diffuse Nacht mitten im Grün zwischen Zivilisation und Natur ? Welche Operation steht hier bevor? Die penible Ordnung und die latente Bereitschaft legt schon eher den Verdacht einer Invasion nahe als Futtermittelproduktion. Man kann nicht umher: diese Landleute sind verschlossen und undurchsichtig, sie töten den Fremden schon, bevor er das Dorf betreten hat. Im feuchten Untergrund zwischen Stadt und Natur haben sie ihr Haus gebaut, und das verschließt sich beim ersten Blick hermetisch und versinkt vor deinen Augen im Sand: die Dächer bis auf den Boden gezogen, die Hecken mannshoch und kein Mensch weit und breit...
Vielleicht sind die Leute schon längst unter den erdrückenden Gemütslagen von Produktion und Notwendigkeit versunken. Vielleicht sind die Pappeln so unecht wie sie scheinen und diese akribische Organisation der Natur nur eine Modellandschaft, in der sich die Mörder ihre Hecken aufgestellt haben, um dort ihre geheimen Wünsche zu vergraben. Die Bilder scheinen das alles zu bestätigen, und wenn man den Pool sieht denkt man folgerichtig nicht ans Baden sondern an die versteckten Träume, die eines Morgens wieder obenauf treiben.
Aber diese inzestuöse Verschlossenheit der Szenerie, mit deren nach Innen gewendeten Räumen und gemutmaßten Handlungen man unter keinen Umständen in Verbindung gebracht werden möchte, ist trotzdem erfaßt von etwas Äußerem, was die Situation statt sie zu erleichtern schon wieder merkwürdig bedrückt: das Licht hat seine universale Weite eingebüßt und den umgebenden Raum zu einer gläsernen Glocke geschrumpft, innerhalb derer sich alles wie auf dem Tisch eines Planspiels zu bewegen scheint. Der Einfallswinkel des Lichtes legt die Vermutung nahe, daß dieser Raum nicht viel weiter reichen kann als gerade ein wenig hinter unseren Rücken und in geringer Höhe eine verdunkelte Hemisphäre überspannt, an deren Aussenmembran wir von innen über die Landschaft gezogen werden: kein Horizont, kein Universum, nur die Bedrückung einer modellhaften Natur und dieser ländlichen Enge bleibt, während sich selbst auf dem See nur dieses künstliche Licht spiegelt, das aus unserer Richtung zu kommen scheint.
Und wo sind die Besucher, die Fremdlinge im Dorf, wo ist unsere Position in diesem Szenario? Nun, sie ist in gewisser Weise modern, was Hoffnung weckt: aus der Distanz betrachten wir die Szenerie (in der wir um Gottes Willen nicht ausgesetzt werden wollten) meist leicht von oben: es scheint dieser uns bekannt- bequeme Blick zu sein, in dem man sich vom Geschehen unter dem Vorwand distanziert, Klarheit zu schaffen: Klarheit durch Überblick, Klarheit durch Reflexion, Klarheit durch Erkenntnis, Klarheit durch die teilnahmslose Position eines Außenstehenden. Der scheinbar souveräne Beobachter als die Parabel, nach der durch Abstand Klarheit entsteht und Wissen die Angst besiegt.
Doch besagtes Rund in unserem Rücken bedrängt stetig mit dem Verweis, daß wir zu dieser Seite des Gefäßes gehören und da, wo man schon Hoffnung schöpft, hält die aufklärerische Perspektive nicht, was sie verspricht. Die Bilder deplazieren den Betrachter, anstatt ihm die Königsposition zuzuweisen: entgegen der erhofften Klärung in der Distanz öffnet sich der Blick in der Entfernung einer subversiven Ungenauigkeit: die Dinge verlieren an Präzision, sie verklären sich in kaum spürbarer Abstraktion (und nicht in romantischer Entrückung), sie geraten in den Unschärfebereich von Ambivalenz, Spekulation und unerhörter Mutmaßung, die einer virtuos kalkulierten Unaufmerksamkeit des Malers gegenüber seinem Objekt entspringt. Selbst da, wo das spärliche Licht hinfällt, erhellt es ständig nur eine erneute Verunsicherung.
Wenn sich aber - und das ist vielleicht das Erschreckende - trotz Distanz und Beleuchtung die Lage stets verschärft, stellt die Arbeit nicht nur das System der Aufklärung in Frage, sondern es entsteht eine erstickende Unruhe, die den unangenehmen Verdacht nährt, daß es zwischen uns und uns eine Distanz gibt- eine Distanz, die der Beschriebenen sehr ähnlich ist.
Bei dieser Vermutung - und es ist für eine Arbeit sicher entscheidend, wann, wo und in welcher Transformation man in das Bild gelangt - wird man selbst der Ambivalenz des Szenario so ähnlich und sich selbst so fremd, daß man unweigerlich im Schatten des Wirtschaftsgebäudes auftaucht, während man noch von oben beobachtet. Man hat seinen Platz verloren. Man ist nicht mehr der, dem die Landschaft vorgeführt wird, sondern der, den die Landschaft vorführt. Man muß augenblicklich davon ausgehen, daß die Geister da unten nicht den in der Szene verteilten Undeutlichkeiten entspringen sondern demjenigen, der sich soeben in einer unangenehmen , fast taktilen Nähe zu uns eingerichtet hat, der uns so täuschend ähnlich aber doch nie gleich ist (weil er uns entspringt), der diese Häuser dort unten wie ein nur uns bekannter Fremder bewohnt, der den Garten hinter der mannshohen Hecke umgräbt und der uns ohne Zögern sofort töten würde, würden wir ihn jemals in dem Haus hinter den Pappeln im Zwielicht antreffen
